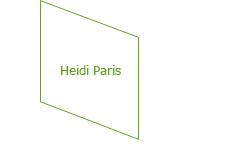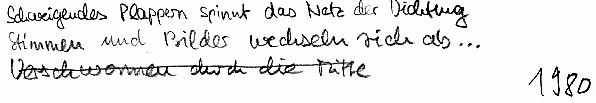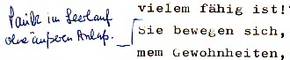[Nomaden] Wahrheiten? Ort für den Unterschied?
Schreiben, was in mir spricht, zu mir spricht, Befehle erteilt: schreib! Hilflos wendet sie sich um, traut kaum zu fragen, was sie denn eigentlich schreiben soll, erstickt sich fragend selbst, antwortet ohne die Frage: schreibend! Wissentlich den Gegenstand vermeidend, den sie ohnehin nicht wußte, bemüht sie sich, den Strom ohne Stockungen fließen zu lassen. Ziellos jeder Wendung folgend, sich selbst verführend, ohne zu wissen wohin. Niemand hat sich wohl je gefragt, wohin er schreiben soll, in welche Richtung. Sicher, der Sinn gäbe die Richtung an, aber welcher Sinn? Der Schreibsinn liebt die Leere, wird angezogen von einer Ahnung, die zum Befehl wird: schreib!
Sie hatte sich manchmal klein gefühlt, jetzt dagegen lag ein ein wendendes “doch …” auf ihrer Stimme, die hoch flüsternd die Luft einsog. Die Klischees aller Redewendungen zogen an ihr vorbei, kein unberührtes Fleckchen, “doch” tönte es wieder, das unberührte Fleckchen liegt in der Kombination! Tausend Ebenen, Ablagerungen, tibetanische Ebenen, ebene Erden und eben jetzt gerade, mathematische Ebenen, Bildebenen und Denkebenen bieten sich zum Wechselspiel.
Sie war wieder ödipal zurückgekehrt, suchte vergebens Anschluß an den Fortgang der Gedanken, rannte ihnen nach und merkte nicht, wie sie dabei immer rückwärts zum Ausgangspunkt zurückflog. Vorwärts, dem Sehen zugewandt, nicht rückwärts, den Knoten. Sie hatte die Richtung verloren, ohne ihre Richtung zu kennen. Sie hatte die Richtung verloren, ohne ihre Richtung zu kennen, sprach das Echo mit dem Gestus der Besserwisserei. Sie tastete also mühsam angestrengt im Dunkel, viel zu konzentriert, um irgendetwas wahrzunehmen. Nur die Stimmen, Befehle der Besserwisser, hallten in ihrem Ohr. Sie hatte keine Gedanken, weil die Ohren schon voll waren. Voll von den Echos, die sie nun gleichfalls leise flüsternd auch denken konnte. Sie drehte sich im Kreis, konnte es denken und nicht aussteigen, zog eine neue Schlaufe und erreich dieselbe Ebene, die inzwischen höher und höher in Kreisen aufstieg. Leere überfiel sie, dünne Luft, langsam des Suchens müde, wo doch kein Weg war. Eine unendliche Linie zeichnete sich ab, sie galt der Zeit und nicht der Richtung.
Nun begriff sie, daß das Ziellose nicht zeitlos war, sondernd gerade ihr gewidmet. Das Ziel hingegen setzte die Zeit außer Kraft, vergißt die Zeit. Mit diesem Gedanken wettete sich jede Sekunde zu Jahren, viele ungewöhnliche Schritte taten sich auf, ungeahnte Räume könnten erfunden werden, wie der einer richtungslosen Zeit.
Nicht mehr nur vorwärts, eher seitwärts, schräg, in die 4. Dimension vorstoßen, von der so viele träumen. Warum diese Räume zählen, warum sie nicht einfach eröffnen? Ihr Kopf, die Kiste, erschrak bei dem Wort “eröffnen”, wollte sie doch mit aller Kraft geschlossen bleiben, nicht weil sie eine Leere barg, wohl eher weil sie den Zerfall ihrer Schutzwände fürchtete. Die Poren krampften sich zusammen, der Angriff kam von außen, und die Kiste hatte nichts als ihr Außen zu verteidigen. Denkräume eröffnen muß etwas anderes sein, als Kisten öffnen, denn das sind ja die alten Orte des Denkens. Sie merkte, wie sie schon von jenseits der Grenzen des Denkens aus dachte. Sie war Beobachter ihres Denkens geworden und beschrieb schon lange ihr altes Denken. Wo war sie also, wenn nicht in ihren Gedanken? Und wer dachte dann dort?
Sie durchschaute die alten Gedankengänge, diese leeren Stollen und Röhren und dachte doch an nichts anderes als an ihre schützenden Wände. Sie dachte die Begrenzung ihres Denkens, tastete es ab nach Verlauf und Beschaffenheit, fand nichts besonderes, nur das ihr schon bekannte und wußte doch, daß in der bloßen Beschreibung die Entdeckung lag. bei dieser Erkenntnis schrieb sie umso munterer los, glücklich, die Frage nach dem Gegenstand ihres Schreibens, dem “WAS”, vergessen zu haben. In Wirklichkeit bannte sie eigentlich nur diese Frage, indem sie behauptete, sie vergessen zu haben. In Wirklichkeit deckte sie schreibend diese Frage zu, maskierte sie unter allen möglichen Vorwänden, suchte nach allen möglichen Umwegen und fand auch tatsächlich nichts anderes als diesen Weg.
Deleuze und Guattari begegneten ihr, Foucault als das Labyrinth von Borges, Postkarten aus der tibetanischen Hochebene grüßten sie, sie lachte und war glücklich aus dem Kreislauf ausgebrochen, in die Bilder eingetaucht, nur durfte sie nicht rasten, sich nicht ausruhen, sie mußte mit der Geschwindigkeit ihrer Gedanken mithalten. Wenn sie zurückblieb, kehrte sie zum Ausgangspunkt zurück, stellte sich etwas abseits auf und wartete auf den nächsten Zug, auf den sie aufspringen konnte. Nur ihre Besserwisserei hielt sie dann und wann noch zurück, angeblich käme noch ein besserer Zug, ein ihr adäquaterer Zug, der ihr ähnlicher sei. Aber gerade das Gegenteil, schon das Geringste oder gerade das Geringste erwies sich meistens als besserer Anknüpfungspunkt, Trittbrett, Einstieg. Sie hatte Lust, in ihr eigenes Lenken einzusteigen, nicht in die alten ausgelatschten Bahnen, eher wohl in die uferlosen Ströme, deren Subjekt sie nicht war, das unbeherrscht sich jedem Zugriff erfolgreich entzog und jeden mit Leere schlug, der sie besitzen wollte. Auch Beobachter blieben bilderlos zurück.
Jetzt hatte sie tatsächlich zu lange bei dem Beobachter verweilt, ihn zu genau beobachtet und dabei wieder den Zug verpaßt. Sie starrte ins Leere und hoffte nur, daß sie niemand ansprechen und danach fragen würde, auf “WAS” sie denn wartete. Sie konnte schlecht antworten, daß sie auf den nächsten Gedankenzug wartete, und außerdem wußte sie, daß sie möglichst so tun mußte, als wartete sie nicht darauf, jedenfalls nicht auf einen bestimmten. Sie war sicher, daß sich, je mehr es ihr gelang, auf nichts bestimmtes zu warten, umso eher die Gelegenheit böte, sich wieder hinterrücks mit den Bilderströmen vereinigen zu können.
Wichtig war dabei, nicht klar und scharf geradeaus sehen zu wollen, sie mußte eher aus den äußeren Augenwinkeln in entgegengesetzte Richtungen schauen, unbestimmt auf zwei Punkte, die schräg, fast hinter ihr lagen. Meist kamen die Bildreihen von links, und erst wenn sie rechts fast vorbei waren, wurde sie gewahr, was sie gesehen hatte.
Nun half es ihr aber gar nicht, wieder nach links zu schauen und auf den nächsten Schub zu warten, dennoch war sie des öfteren dazu gezwungen wegen der unterschiedlichen Geschwindigkeiten von Bildern und Schreiblinien. Manchmal ärgerte sie sich über den Erfindungsmangel, den Mangel an adäquaten Aufzeichnungsmitteln, dann aber, bei dem Gedanken an Tonbänder, erschrak sie über das laute Echo ihrer im Kopf vorgestellten Stimme und zog das hohe Flüstern ihrer Besserwisserei vor. Wenn sie ihre Besserwisserei genauer betrachtete, so war es eher eine befremdliche Art von Ratschlägen, die sie keinesfalls befolgen mußte, es war freigestellt. Meistens hatte sie sich gegen diese Besserwisserei zu stark aufgelehnt und so verkannt, daß sie ja auch als jemand betrachtet werden konnte, der auch nur so dahin redet. Also konnte sie der Besserwisserei ruhig folgen, hatte sie doch ihren Charakter verloren und erwies sich überdies als viel produktiver als die viel zu selten vorbeikommenden Züge, Bildreihen, Schübe.
Inzwischen zogen diese Gedankengänge viele Beiwagen mit sich und gern hätte sei einige von ihnen abgekoppelt, um wieder an Fahrt zu gewinnen, loszureißen, abzureisen, andere Gedankenverbindungen eingehen zu können. Allerlei Grabsteine mit Kurzworten der letzten Jahrhunderte tauchten auf: dazumal, mancherlei und überdies. Stumm boten sie ihre Oberfläche an, allein der Klang blieb erhalten: voll und tief, mit kurzen leichten Glucksern. Sie mochte den Klang dieser alten Wörter, hätte gerne noch viele genannt, allein der Klangteppich war ihr präsent.
Auch hier wieder erwies sich die Methode des unscharfen Hinsehens oder besser wohl des daneben Hörens als richtig.
Alle Sinne schienen wohl die merkwürdige Eigenschaft zu besitzen, sozusagen nicht bei Volleinsatz ihrer Kräfte, also eher unkonzentriert, am meisten zu leisten: sei es nun sehen, hören oder andere Sinnestätigkeiten. Der Sinn für unentdeckte Sinne schien dabei am schlechtesten ausgebildet zu sein, jedenfalls jagte er immer der alten Vorstellung von dem Sinn nach und vergaß dabei seine Funktionen, fast hätte sie gesagt: “seinen eigentlichen Sinn”.
Bildreihen und Stimmen schienen sich in ihrem Denken zu trennen. Sobald sie sah, verstummte ihre Stimme, sobald sie sprach, verschwanden die Bilder oder nur Reste blieben stehen. Doch diese Erkenntnis änderte nichts, uns je öfter sie sie auf die Probe stellte, umso platter, intensitätsloser wurde die Erkenntnis. Platonische Erkenntnisse ödeten sie an, jedenfalls lohnte es nicht, bei ihnen zu verweilen. Es waren unfruchtbare Erkenntnisse, nichts knüpfte daran an, nichts wucherte von dort aus fort. Sterile Erkenntnisse, leblos. Mögen sie verstauben in einer unbedachten Ecke, im leeren Winkel ihres Denkens. Dort in den verstiegenen Ecken fand sich noch nie ein guter Gedanke. Höchstens nostalgische Dinge, Firlefanz, reine Zierde, verdoppelnde Rahmen,die nicht mehr nötig waren, um aus den eingefahrenen Bahnen auszubrechen. Immer schon anderswo, sah sie die Grenzen nur noch vom Jenseits ihrer selbst aus. Endlich entfiel damit auch das harmonische Denken, das von zwei sich ergänzenden Hälften ausging, die selbst abgeschlossene Teile bildeten. Kein offener Horizont für sie, wie ihn das anderswo eröffnet. Müde sinkt sie zurück, die Weite genießend.
Das Nichts, das die Leere ist, beunruhigt und schickt auf die Suche, findet, reduziert auf nichts, jeden beliebigen Anknüpfungspunkt. Diese Oberfläche, die klar ist und ohne Mangel, nichts dahinter, abperlend glänzend und kein Schauspiel!
Nichts suchend, findet sich alles. Suchend bleibt nur die leere Abwesenheit. Anwesend und doch immer anderswo arbeitet das Unbewußte an der Oberfläche und nicht in der Tiefe, wo wir vergebens forschen. Bilder anschauen, kombinieren, Geschichten erzählen, Bilder entwerfen, die alles in sich aufnehmen und es doch entstellen. Bilder finden, die aus Gewohnten Bahnen werfen, anders funktionieren. Z. B. die Zeitvorstellung die auf mir lastet, als müßte ich sie unermüdlich füllen, wegarbeiten, vergessen. Die Vorstellung von der reinen Zeit, wie kam sie bloß in meinen Kopf? Wodurch bemerke ich sie und wodurch bemerke ich sie nicht? Es ist unbequem, sie zu merken, sie fordert ihre Anschaffung, ihre Veränderung. Sie ist an Warten Gebunden oder an Nichts-Tun, was auch Warten ist, nur unbestimmter, quälender. Zielgerade schießt sie auf das “Was” zu, “Was tun?” Unruhe steigt auf, und warum sollte nicht alle Unruhe aus dem Nichts-Tun entstehen, aus der leeren Zeit? Die Arbeitslosen, die Streiks, die grundlose Unruhe, die zu so vielem fähig ist!? Wozu eigentlich, wenn nicht zur Unruhe selbst: Panik im Leerlauf ohne äußeren Anlaß.
Sie bewegen sich, setzten sich in Bewegung, die alten eingefahrenen Gewohnheiten, verlassen Häuser des Denkens und bevölkern die Sinne, verlassen Häuser des Bleibens und füllen die bewegten Straßen der Unrast. Nomaden ohne Rast, Arbeit ohne Reproduktion, alles verknüpfend, fortspinnend, die unendliche Linie. Ich liebe die Endlichkeit, den Bruch, das Ja zum Tod, worin ich die Vergänglichkeit der Dinge akzeptiere und nicht die Abstraktheit einer Idee. Fixe Ideen führen zu nichts, und doch liebe ich dieses Unruhe stiftende Nichts, diese Leere, die Implosion.
Dazu ist es nötig, viele Bilder zu haben, die dieser Unruhe eine Wende geben, damit sie nicht so schnell in den gewohnten Bahnen Schutz suchen, den allzu bekannten Meetings, Demos, Kongressen, Reden usw. Ein Tun, das Wirklichkeit schafft und nicht ein Schauspiel, das das Tun verdoppelt. Auch Verweigerung hilft da nicht aus der Klemme.