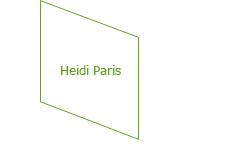Indien, Goa / Japan, Kobe, Kyoto / Indien, Bombay, Goa (1993/94)
Indien Vorbereitungen:
Baumwolle
Gewürze
Leder
Schmuck
Wolle
Reis Tee
Kautschuk
Mohn
Öle Räucherstäbchen
HÄNDLER
Brahmanismus
Hinduismus
Buddhismus
Sikhs
Weda
KASTEN
Grammatik
Mathematik (arab. Zahlen)
Chirurgie + Heilpflanzen
Alt-indisch (San[s]krit)
Mittel-indisch (Pali)
arabische Zweige des indogermanischen Sprachstammes
Religiöse Tanzdramen
– Weda
– Brahma
– Shiva
Shiva:
männl. ekstatischer Tänzer
einer der Hauptgötter des Hinduismus
Weltzerstörer und Heilbringer
Wohnsitz: der Berg
Tanzfiguren – abstrakte Bedeutung:
13 Kopfbewegungen
9 Augenbewegungen
9 Nackenbewegungen
10 Füße
5 Sprünge
8 Haltungsweisen
Musikinstrumente:
Sitar
Tabla
Weda Veda
– älteste heilige Schriften der Inder, ca. 1250 v.Chr.
– Sammlung von Liedern und Sprüchen
– Texte in Prosa (Brahmanas), die die heiligen Handlungen im einzelnen beschreiben
Sutras
– Lehrbücher für Kultur und Recht
Rigweda, 1028 Hymnen an einzelne Götter
gruppieren sich in 10 Mandalas (Kreise)
Brahmana
– zeitlich anschließend an die Veden
– Brahmane: Mitglied der obersten Kaste der Hindus (Priester, Dichter, Gelehrte, Politiker)
– Gesetzbücher der Heiligkeit
1000 v. Chr. Kastenordnung, Opferwesen, acht d. Priestertums, Anfänge der Seelenwanderung, Erlösungssehnsucht und Askese
Brahma: Weltschöpfer
Wischnu: Welterhalter (in menschl. Gestalt
– Rama und Krischna)
– Shiva. Weltzerstörer
Hindu
egal welcher Glaube, Zugehörigkeit zu einer Kaste
Entstehen und Vergehen der Welt, das bei den Pflanzen beginnt und bei den Göttern endet;
Kosmos beherrscht vom Vergeltungsgesetz, dem Karma
Gottheiten, Geister, Dämonen und Heilige.
Die Götter sind Naturelemente:
– Indra – Regen
– Surya – Sonne
– Soma – Mond
– Wayu – Wind
– Agni – Feuer
– Waruna – Wasser
– Yama – Tod
– Kama – Liebe
Buddha
– im San[s]krit bedeutet es der Erwachte, der Erleuchtung erfahren hat,
– Religionsstifter 560 v. Chr., persischer Name Siddharta
– aus Adelsfamilie im Tibet
– 6 Jahre als Bettelasket wandernd, Predigten z. T. überliefert
1. Leiden
2. Leidenschaften
3. Aufhebung der Leiden
4. der 8fache Pfad:
– rechte Anschauung
– rechte Gesinnung
– rechtes Reden
– rechtes Handeln
– rechtes Leben
– rechtes Streben
– rechtes Denken
– rechtes Sichversenken
Wiedergeburt unter Karma
Eingehen ins Nirwana
Ich bin in Indien, dem Lande Gandhis, dem Land der Hindus, dem Land mit dem Tanz von Shiva. Ich sitze auf der Veranda des gemieteten halben Hauses und sehe das Meer und den Sonnenuntergang. Ich schreibe. Die Raben krähen auf den Hütten und in den Palmen, von nah und fern. Jemand hämmert Holzlatten zusammen. Der Wind trägt süßliche indische Tablamusik mit einschmeichelndem Liebesgesang herüber. Am Morgen noch die kräftigen Luftsprünge der gejagten Delphine, mittags dann ein Gespräch über den Gleichmut der Inder angesichts weltweiter Entwicklungen, nun Ausklang des Tages. Und traumversunken verstreicht die Zeit. Wieder unterwegs auf großer Fahrt, den vergessenen Träumen ein wenig nähergekommen. Und wieder erfüllt sich etwas ganz anders als gedacht.
Gerne schaue ich den spielenden Hunden zu, wie sie herumtollen, plötzlich innehalten und schnuppernd irgendeiner Spur nachgehen, die sie mehr interessiert als das Spiel, dann spurten sie unvermittelt wieder ihrem jungen Spielgefährten nach.
Henri Michaux’ Barbar in Asien ist die richtige Reiselektüre. Er kann Mentalitätsräume abstecken, die Schwellen von der Haltung der Hindus zu denen der Nepalesen beschreiben, ein Schwellenwechsel vom Gleichmut zum Lächeln.
Indien ohne Fragen nach dem Glauben oder der Weisheit ist nicht Indien. Der achtfache Pfad oder das kleine und große Gefährt. Was ist das Nichts? Oder besser: die Leere, aus der die Fülle wird? Einen Gedanken so lange ausschöpfen, bis man an seinen Rahmen stößt. Ob Indien noch aus den Kasten herausfindet durch eine Revolution? Ist es wünschenswert? Tempel, Schreine, Pagoden, Stupas, Moscheen, Synagogen, Kirchen. Auf dem Weg.
Und dann lenkt sich der Blick auf die Schwelle zwischen Europa und Asien, nach der fließenden Grenze, die durch Rußland läuft, in der Mongolei mit den Mongolenaugen, zur Steppe der Nomaden und von dort mit Dschingis Khan im Ansturm nach China zur Mauer und dem Kaiserpalast und den Ausgrabungen der steinernen Heere. Von dort schweift er nach Tibet, Nepal, Indien. Mit einem Sprung schafft man es nach Kashmir. Eine andere Region ist Japan, Korea. Kühle Klarheit, rationalistisch gewendet. So schnell überfliegen die Gedanken die Zonen der Wünsche.
Der Traum von Südostasien begann mit Indonesien. Java, den Südseegesichtern wie Blumen, eins schöner als das andere. Unvergeßliches Lächeln. Schwerer, süßlicher Blütenduft. Feuchte Luft, Leinenhandtücher.
Die heiligen weißen Kühe vor der Veranda fressen die Blätter vom Bananenbaum, aber sie fressen auch viel Pappe. Vom Nachbarn schallen die alten Hits aus der Rockgeschichte herüber. In der Mittagshitze liegen die Glieder schwer ausgestreckt. Der Ventilator fächelt kühlende Luft von der Decke. Die Mutter vom indischen Hausbesitzer putzt für uns (1,- DM pro Tag). Die Übernachtung kostet 11,- DM. Dann überwindet man die Steinesschwere des Leibes, ein Ruck, ein gemächlicher Gang durch die Sonnenglut, die um diese Tageszeit brennt, durch die Dünen, schon kühlen die Meereswogen wuchtig das Gemüt. Danach ein Glas Tee in der schattigen Bastmattenhütte am Strand. Hier sitzen noch ein paar vereinzelte Typen aus aller Welt. Globetrotter. Die einen trinken Bier, die anderen spielen Handbillard, die Diener schlafen hinter der Bastmatte, wo noch ein Campingkocher steht. Der Boss bietet mir für Morgen noch eine spezielle Teemischung an. Aber ich weiß nicht, welches gun powder er mir da zusammenmischen will. Wir belassen es bei einem may be.
Schön, daß es hier so unaufdringlich zugeht. Auch mit den Händlern kann man jederzeit statt über die wieggleiche Ware auch über seinen Heimatort reden, denn sie kommen alle nur zur Saison über die Weihnachtsfeiertage oder zur Wintersaison hierher nach Goa, der reichsten Provinz Indiens.
Schon scheinen die Namensstädte der vier Himmelsrichtungen auf: im Westen Bombay, im Norden Dehli, im Osten Kalkutta, im Süden Madras. Kalkutta am Ganges, dem Ort für die Sterbenden, von wo aus man direkt ins Nirwana eintreten kann, der Station “of no return”. Kalkutta auch die Stadt der Seuchen. Madras lockt mit etwas noch verführerischem Fremdländischen.
Die Yoga-Meditation ist eine Praxis, aber manchmal liege ich auch einfach nur im Schatten der Fischerboote und schaue dem aufsteigenden Kreisen der einzelnen Möwen in der weiten Höhe des hellblauen Himmels zu.
Schnell vergeht die Zeit, die Tage zwischen Schlafen und Wachen, Essen und Schwimmen, Lesen und Sinnen. Ein Gleichmaß ohne Regressionen.
Und dann sieht man die Kinderarbeit überall. Mit 10 Kilo schweren Obstkörben gehen sie den Strand ab, in den Bambushütten räumen sie die Tische leer, bei den Fischern legen sie die Netze zusammen. Für ein kurzes Spiel mit dem Ball dürfen sie dann wieder Kind sein.
Weihnachtsabend in großer Runde: Langustenessen mit Champagner. Leichtes ungezwungenes Plaudern zwischen Holländern, Amis, Franzosen, Deutschen. Musiker, Schwule, Schwarze, Redakteure.
Dann eine Stunde nach Mitternacht Aufbruch zu einem Dschungelflecken im Norden, 45 Minuten per Auto entfernt, wo tausende von Freaks versammelt sind und noch strömen sie zu Fuß, mit Motorrädern, Rikschas und Taxen. Es dröhnt im Gedränge der Techno-Sound auf höchster Voltzahl in die Nacht. Alle sind drogiert, betrunken, ekstatisch tanzend. Diese Parties sind weltberühmt. Über Weihnachten und Neujahr treffen hier Discjockeys aus LA., New York oder Berlin ein und heizen die Stimmung auf mit den neuesten Musikentdeckungen. Hier wird Rockgeschichte geschrieben.
Wir schieben uns mit einer Pulle Bier durchs Gewühle. Als es zu beklemmend wird, suchen wir das Weite. Auf dem Vorplatz, dem freien Feld, tausende Quadratmeter ausgebreiteter Bastmatten, wo im Schein der Petrolumleuchten die einheimischen Inderinnen auf Bunsenkochern Tee zubereiten. Hier lassen wir uns nieder, plaudern und lassen uns die leckeren Kekse schmecken. Gegen 4 Uhr morgens brechen wir auf, heimwärts.
Hat man in dieser dekadenten Atmosphäre vergessen, in Indien zu sein, die abenteuerliche Heimfahrt in der Rikscha bringt es schlagartig zurück: here we are.
Ein Morgenbad im Meer weckt die übernächtigten Geister. Die Kellner sind in Festtagsstimmung. Der Gleichmut ist einer spielerischen Fröhlichkeit gewichen. Sie spielen wechselseitig Gäste, die sich über den schlechten Service beklagen.
In einer der Bambushütten am Strand hängen leere Vogelnester zur Dekoration an den Bastwänden. Es sind filigrane, stromlinienförmige Kunstwerke mit aerodynamischen Einflugschneisen.
Hier in der Gegend sind die meisten Inder katholisch, von den Portugiesen bekehrt, die bis 1961 diese Provinz beherrscht haben, bis sie binnen 1 Woche ohne Hab und Gut davongejagt wurden und ihre Negersklaven zurücklassen mußten. Diese haben übernommen, was da war und so sieht man viele Domestikenmischlinge, die nicht zu erkennen sind an der Hautfarbe, denn in diesem südlichen Teil Indiens ist die allgemeine Hautfarbe schon sehr dunkel, sondern nur sichtbar an dem stumpfen Kraushaar im Vergleich zu dem sonst bläulich schwarz schimmernden Glanzhaar.
Die Ernährung ist nicht sehr variantenreich. Reis, Tee, Curry, Zwiebeln, Tomaten, Eier, manchmal Huhn oder Fisch. Die gummiartige Marmelade und die Plastikmargarine umgehe ich. Fleisch sollte man unbedingt meiden. Trotzdem erwischt einen ab und zu der Durchfall. Da helfen nur Kohletabletten en masse und warme süße Limonade.
Das Geldtauschen und die Post sind ein Akt für sich. Hinter verrosteten Eisengittern schiebt der Beamte die Briefmarken herüber. In dem kleinen Raum dahinter sitzen drei Beamte um einen großen Tisch, auf dem sich Berge von Post türmen. In Zeitlupe nehmen sie jede Postkarte in Augenschein, als wenn sie die Botschaften zu lesen versuchen, setzen bedächtig ihren schweren Stempel darauf und legen sie auf einen unsichtbaren Nachbarhaufen. Man hat den Eindruck, die Berge nehmen eher zu als ab. Erst versuche ich meine Post in den großen Schlitz einzuwerfen, dann sehe ich, daß sie auf halbem Wege abwärts hängenbleibt, ich fische sie wieder heraus und reiche sie durch ein offenes Seitenfenster den Beamten am Tisch und sage laut und vernehmlich “To Europe”. “Thank you” schallt es zurück, als wenn ich ihnen die Hälfte der Entzifferungsarbeit abgenommen hätte. Die Karten werden umgehend bearbeitet. Das ist hier die Express-Post denke ich und ziehe beglückt ab.
Die Horizontlinie ist schnurgerade. Und immer wieder verblüfft, daß es dahinter weitergeht, weiter geradeaus bis Persien vielleicht. Ein Wunder, daß die Schiffer eines Tages wieder Land erreichten. Von den vielen, die nie wieder Land sahen, erreichte uns keine Kunde, Nachricht, Epos, aventiure.
Ein junger Hund, der um die nackten Beine streift, unterbricht den Gedankengang. Plötzlich tauchen nahe der Küste zwei Delphine auf. Große Aufregung unter sonst eher schläfrigen Bambushütten. “Da, da, jetzt springt er wieder!” Die Fischer berichten, daß sie schon, als sie klein waren, mit ihnen geschwommen sind. Dann kehrt wieder Ruhe ein. Die indische Liebesmusik legt sich süßlich wie ein Parfümschleier über die eingekehrte Stille. Erst seit einem halben Jahr gibt es hier in der Gegend Telefon. Und wir schreiben das Jahr 1993.
Ich überlege, nächstes Jahr für 4 Wochen alleine hierher zu reisen. Jetzt, wo mein Reisegefährte mal für einen Tag krank im Bett liegt und ich allein rumziehe, scheint mir der Tag und die Stunden und Minuten viel länger. Sind 4 Wochen dann nicht zu lang? Gerne würde ich etwas weiter in den Süden reisen. Marc, der schwarze Mischling aus Holland, hat von der Stadt Mysore erzählt und von dem Hotel im Kolonialstil dort. Seitdem träume ich davon, 24 Stunden im Zug weiter südlich zu fahren. Werde ich allein den Mut dazu aufbringen? Es wird Zeit, daß ich den Absprung finde.
Die Darstellungen der Gottheiten sind häufig mit zwei Armen, manchmal mit Elefantenrüssel, Mischungen aus Mensch und Tier, wie vielleicht die Sphinx eine ist. Alles in kräftigen leuchtenden Farben. Bisher kannte sie diese Darstellungen hier nur von Postkarten. Gerne würde sie diese Darstellungen mal in Holz oder Stein sehen. Dazu müßte sie in Indien weiter herumreisen. – Die bronzene Shiva-Figur, die sie in ihrer Buch der Tanzgeschichte in der Kunst abgebildet gesehen hatte, diesen Tanz hatte sie empfunden, schnell wie der Blitz. Dabei hatte sie nichts Göttliches empfunden, eher ein erfreutes Staunen, daß es so etwas tatsächlich gab, diese Blitzesschnelle eines auf einem Bein sich im Kreise Drehenden, der die Arme dazu schlägt in Wellenbewegungen mit dem Wirbel, den wir im Wind empfinden. Shiva stellt Zorn, Feuer, Reinigung, Wandel dar, nicht Vernichtung.
Die einheimischen Zigaretten waren ein kleines Wunder. Das kunstvoll gewickelte und gefältete runde Päckchen “Zigaretten” kostete umgerechnet 5 Pfennig und enthielt 20-30 Stengel, die jeweils aus einem einzigen gedrehten Blatt Tabak bestanden, das mit einem winzigen Fädchen am Ende zusammengehalten wurde. Dafür mußte man daran ziehen wie der Teufel, damit sie nicht ausging und behielt nur den Tabakgeschmack im Mund zurück. An Rauchen war gar nicht zu denken, so schnell gingen sie immer wieder aus.
Die meisten Götterdarstellungen waren im Lotussitz, den sie als 5-jähriges Kind in der Ballettschule lernte einzunehmen. Es ist mehr als ein Schneidersitz. Bei einem Yogi- oder Buddha-Sitz werden die Füße durch die Kniebeuge gezogen, so daß die Fußsohlen nach oben zeigen. Für den normalen Europäer ein Ding der Unmöglichkeit. Vielleicht für einen 10 Jahre lang Meditierenden eine Selbstverständlichkeit. Wenn sie annähernd diese Haltung einnahm, straffte sich der Rücken fast automatisch kerzengerade in die Höhe, das Steißbein wurde zum tiefsten Punkt des Körpers, auf dem das gesamte Gewicht aufruhte und die Atmung verlangsamte und vertiefte sich. Ihr gelang es, den Rücken zu beatmen, das Becken und von da aus spürte sie die Kraft ausstrahlen. Nur ärgerlich, daß dabei immer die Beine einschliefen. Sie dachte an den kleinen Meditationshocker, den sie in Berlin im Schaufenster gesehen hatte.
Noch nie bin ich einer solchen Sprache begegnet. Nicht ein Laut, eine Silbe, eine Melodie, die ich aufschnappen konnte. Sonst hörte sich das Ohr ein, kroch in den Sound, machte spielerisch nach, wiederholte, las, wiederholte, wendete an, merkte sich, lernte. Hier nicht so. Leise nuschelnde Stimmen ohne Absätze. Scheinbar sehr lange Wörter. Auch ließ sich nicht von der Schreibweise auf die Aussprache schließen. Der Nachbarort, wo wöchentlich Markt stattfand, schrieb sich Mapusa und wurde gesprochen Mopsa. Außerdem bewirkten die vielen unzähligen Dialekte im Lande, daß ein- und derselbe Städtename viele Aussprachen hatte. Unterhielten sich deswegen viele Inder untereinander fließend englisch? Anyway.
Tagebucheintragung Peter: “Heidi ist sehr fröhlich, lächelt immer und ist sehr aufgekratzt, plaudert mit den Leuten, freut sich über die Tiere.”
Erste Verabschiedungen. Adressen werden ausgetauscht, Versprechen gegeben: “Ja, ich komme wieder. Ja, es gibt ein Wiedersehen.” Ein Wiedersehen mit Jonny, dem Hausbesitzer, mit Esperanza, seiner Mutter, mit Avelino, dem Kellner, mit Marc und John vom Nachbarhaus. Vielleicht mieten wir nächstes Jahr zusammen ein Haus. Und es bleiben die Vorhaben, nächstes Mal länger zu bleiben als nur 11 Tage, Ausflüge zu machen ins Riz-Hotel (Zimmer Nr. 10) in Mysore, nach Hampi zu den in Felsen gehauenen Statuen, von denen Jens mit leuchtenden Augen berichtet hatte.
Die Musikanlage unter der Bambushütte hatte einen besonders guten Klang. Einige Lautsprecher waren in Tongefäßen deponiert und hingen schaukelnd im Wind. Es klang wie aus dem Inneren einer indischen Tabla. Es war leicht bewölkt an diesem Tag. Die Luft war abgekühlt, der Wind frischer. Das ansonsten sonnengelbe Licht war weißer, durchsichtiger. Die Meeresfarbe war graugrün dunkel. Es war milde. Vor der Bambushütte zog ein Scherenschleifer vorbei, sein Tretradgestell über der Schulter. Wie aus einer anderen Zeit schaute sie ihn verwundert an. Es ist mehr als 40 Jahre her, daß sie in Deutschland von Haus zu Haus zogen und nun leben sie hier noch.
Abflug vom Militärflughafen Goa mit der Damania Airline nach Bombay. Die 12 Stunden Zwischenaufenthalt in Bombay überbrücken wir mit einer Taxi-Fahrt in die 38km entfernte City zum berühmten Hotel Taj Mahal. Die Fahrt fährt vorbei an den Elendsvierteln aus Pappe und Wellblech, vorbei an Straßen, wie mit Leichen übersät mit obdachlosen Schlafenden. Der Gestank, Lärm und das Verkehrschaos sind nervend. Nach 2 Stunden Fahrt sind wir in der City. Nach einem Tee in der Sea-Lounge mit Blick auf die Seebucht im Taj Mahal schwebt man bereits über den Dingen. Zurück im Flughafen bin ich erschöpft: Periode, Durchfall, Kopfschmerzen, hinüber. Dabei liegt die Reise erst vor uns: Bombay-Hong Kong mit Swiss Air 4 Stunden und 4 Stunden Aufenthalt.
Die Hongkong-Chinesen in dem hypermodernen Flughafen ohne Ansagen nur mit Monitoren sind geschäftig. Dann 8 Stunden Flug mit Lufthansa von Hongkong nach Osaka. Einreiseschwierigkeiten. Wir können keine Zieladresse in Japan angeben. Man verfrachtet uns in eine Wartekoje, dann soll ich in der Ankunftshalle unsere japanischen Freunde identifizieren, die sind aber nicht da. Verhörähnliche Wartesituation. Nochmals in die Ankunftshalle: endlich sind die Freunde da, um ordnungsgemäß ihre Adresse eintragen zu können. Daß wir Diarrhö haben, verschweigen wir lieber auf den Einreisepapieren, sonst sähen wir nämlich von Japan nichts, sondern nur die Quarantäne-Station. Umstieg von Sommer auf Winter. Isshu und Kimiko begrüßen uns lachend und strahlender Laune.
40 Minuten gemeinsame Bus-Fahrt von Osaka zur Hafenstadt Kobe über Highways vorbei an staunenswerten Leuchtreklamen wie in einer futuristischen Welt. Sushi-Essen in einem vornehmen Restaurant mit Stäbchen, versteht sich. Kostet aber auch die Kleinigkeit von 300,- DM. Unterbringung bei Kazuko, in einem Villenviertel von Kobe. Der Empfang ist überwältigend. An alles ist für den Gast gedacht, vom seidenen Schlafanzug bis zur Zahnbürste. Wir sind fast beschämt. Und glücklich krabbeln wir unter die vielen Decken der Futonbetten im Tatami-Zimmer.
Ausschlafen, Fernsehen, Stadtspaziergang. Kazuko zeigt uns das Notwendige: Lebensmittelabteilung, Bahnstation, Hausschlüssel, japanisches Bad.
Nächster Tag einmal Shopping: Sakamoto-CDs, Stereogramm-Buch, Kulis, Lackschalen. Wir staunen über den hohen Standard und die hohen Preise. Da wir nichts lesen können, zeigen uns die Bildchen, worum es sich bei manchen Waren handelt, auch die Verkäufer sind hilfsbereit, soweit die Sprachkenntnisse eben reichen. So ein kleiner Spaziergang auf eigene Faust in der näheren Umgebung gibt mehr Eindrücke, als zu beschreiben: die vielen Schlitzaugen, da fühlt man sich wie der Neger unter den Weißen. Das Wiederkennen unter den wenigen Europäern oder Ausländern. Die Sprachverwirrung, die Zeichensprache, das Suchen nach Orientierungsleitlinien.
Nachmittags holt uns Isshu mit dem Auto ab, wir fahren zu ihm nach Hause, ca. 1 Stunden Weg über Highways aufs Land, nach Akashi. Eine traditionelle Innenausstattung erwartet uns: leere Räume, kleine Zierecken, flacher Tisch mit Wärmedecke. Das Sylvesterfest verbringen wir an diesem Tisch sitzend, essend, redend, trinkend, mit kleinen Feuerwerkskörpern. Das Essen ist malerisch und mit allen Köstlichkeiten: Seetang, Lilienwurzeln, Lotuswurzeln, Pickels, Maronen, Algen, Lachsrogen, Heringsrogen, Sake, grüner Tee … Das Ganze in Miniatur: Häppchen und Schlückchen, Tellerchen, Schälchen. Untersetzer, Döschen, zart dekoriert. Am Ende des Abends werden die Futons aus dem Schrank geholt und auf den Boden gerollt, schon sind wir untergebracht für den Rest der Nacht.
Am Neujahrstag Ausflug mit Isshu und Kimiko im Lokalzug nach Himeiji zum Tempel, wo man wie beim Lottospiel gute oder schlechte Wünsche auf Papierschnipseln aus einer Dose zieht. Die guten Wünsche für das kommende Jahr steckt man in die Tasche und hebt sie auf, die schlechten werden zusammengerollt an einen Baum gehängt. Vom Tempel aus Spaziergang durch die Festtagsmenge, eine Einkaufspassage mit Buden zum Volksvergnügen, zum Himeiji-Schloß, das über allem in der Ferne trohnt.
Nach der zweiten Übernachtung bei Isshu bringen wir morgens Kimiko mit dem Auto zur Arbeit im Krankenhaus, und fahren dann weiter nach Kobe. Von dort aus nehmen wir die Hankyu-Line von Mikage bis Juso. Umsteigen. Weiter nach Kyoto. Ankunft dort Shijo-Omiya-Station. Wir sind nur damit beschäftigt, uns die Namen und Züge einzuprägen, damit wir auch mal alleine uns auf den Weg machen können. In Kyoto gehts gleich zum Ryoanji-Tempel, dann zum goldenen Pavillon und dann zum Daisen-in der Rinzai-Sekte. Der lachende Mönch dort ist sehr geschäftstüchtig. Er spricht viele Sprachen, lacht, macht Witze, gibt Autogramme. Isshu meint, bei dieser Sekte gehört es zum Initiationsritual, daß man solange redet, bis man leer ist. Peter ist ganz begeistert, rennt strahlend durch die Gegend, will Teezeremonien mitmachen und jeden Winkel der Gärten kennenlernen. Abends nach der Rückkehr in Kobe sind wir ganz erschöpft.
Am 3. Januar ist hier immer noch Feiertag. Wir kümmern uns um unsere Gesundheit, legen eine Ruhetag ein und gehen nur abends zum erstenmal allein in eine Sushi-Bar. Ein kleines Abenteuer, wenn man bedenkt, daß man sich so gar nicht verständlich machen kann und man immer aufpassen muß, daß die Preise nicht ins astronomische steigen.
Am 4. Januar auf eigene Faust von Kobe, der Station Mikage über Juso nach Kawaramachi in Kyoto. Dann zu Fuß bis zur Keihan-Line. Ein paar Stationen, dann umsteigen in die Eiden-Straßenbahn bis Ichijo. Kleines Bergsträßchen 0,8km zu Fuß bis zum Shisen-do-Tempel mit Garten zum durchstreifen. Dann mit Bus zur Imadegawa-Straße. Fußweg durch Budenstraße hinauf zum Ginkakuji-Tempel mit Pavillon und Fuji-Nachbildung. Hier ist ebenfalls die Rinzai-Sekte ansässig. Von hieraus den Philosophenweg 1,8 km am Flüßchen entlang zum Nanzenji-Tempel.
Wir sind aber nicht bis zum Innersten vorgedrungen, weil wir nicht wußten, ob wir richtig sind. Hier war nichts mehr in alphabetischer Schrift zu lesen. Von hieraus Fußweg zum riesigen Heian-Schrein mit Riesenrummel. Alles in orange-rot. Schneller Abgang und Bummel durch das Vergnügungsviertel Gion mit hochmodernen Gebäuden. Eine Art Maschinen-Architektur. Abends hundemüde zurück in Kobe ein Japan-Bad zur Entspannung.
5. Januar. Wieder von Kobe aus auf eigene Faust nach Kyoto gefahren und den Nishi-Honganji-Tempel besucht. Kleines Gebet verrichtet. Im Gemeinde-Haus Mittagessen mit Blick auf Minialleen und Wasserfall. Alles sehr geschmackvoll. Dann Spaziergang zur Kyoto-Station. Wir erwischen den falschen Bus und fahren für viel zu viel Geld zur Endstation und wieder zurück. Schlechte Stimmung. Süßigkeiten heitern auf.
6. Januar. Fahrt mit Isshu und Kimiko im Auto von Kobe nach Kyoto. Ausflug zum Landschaftspunkt Arashijama mit Bergen und Blick in eine Schlucht, wo ein Fluß sich schlängelt. Ein Bild wie auf chinesischer Tuschemalerei. Tofuessen in einem vornehmen Restaurant, wo jeder Gast ein Séparée hat. Anschließend Besuch des zauberhaften Moosgartens Kokedera des Saiho-ji-Tempels mit Sondergenehmigung und Zeremonie (man schreibt gute Wünsche für Freunde und Verwandte auf ein Holzstäbchen, legt es mit Verbeugung auf den Altar und später wird es von Mönchen mit einer extra Zeremonie verbrannt.) Peter ist so angetan von diesem Garten, daß er weint vor Rührung.
Weiter geht’s zum Museum und Tempel Horyuji, wo eine besonders schöne Holzstatue zu sehen ist. Dann weiter auf Peters Wunsch zum Movie Viliage, dem Eiga Mura, eine Art Disneyland auf japanisch. Es ist schrecklich teuer und scheußlich. Kinderkram. Nach einen Kaffeetrinken zum Aufwärmen gehts an den Rand von Kyoto zur Jugendherberge (7 Tsd. Yen pro Person incl. Abendessen und Frühstück). Alles sehr teuer. Dafür ist das Bad in der Jugendherberge eine First-Class-Erfindung, wie überhaupt es hier überall eine hohe Lebensqualität gibt.
Es freut mich, daß Peter Japan beeindruckt, so teilt er doch meine Freude. Und ich bin erstaunt über seine Freude an den Gärten und an den Tempeln und am Beten. Außerdem verführt ihn das Essen hier sehr.
7. Januar. Wir besuchen weiterhin viele Tempel und kaiserliche Residenzen in Kyoto: Katsura, Shugakuin, hinauf auf den Berg (wo es Affen in freier Natur gibt) mit Blick auf einen riesigen See im Tal. Gegen Abend Einkehr im Ritsu-in beim Mönch Shunsho Utsumi, der zur Tendai-Sekte gehört. Sein Initiationsritual bestand in einem 1000-Tage Marsch, täglich 30 km mit anschließendem Fasten und Beten. Wer diese Prozedur durchhält, ist hier der Star. Ein kleiner Small-Talk als Einführung, steifes Sitzen als Ritual, dann weisen uns die Mönche einen leeren Schlafsaal zu, wo für uns alle die Betten ausgerollt bereitliegen.
8. Januar. Um sechs Uhr morgens in Eiseskälte holt uns ein Mönch zur Feuer-Zeremonie ab. Die Holzstäbchen werden angezündet, Räucherstäbchen geschwenkt, Zimbeln und Glöckchen geschlagen, Sutras gesungen-gemurmelt. Wir sitzen steif auf unseren Knien und frieren tapfer. Immerhin ist es eine Zeremonie extra für uns und unsere Gesundheit. – Zum Frühstück sitzen wir in einer Reihe aufgereiht, der Obermönch uns gegenüber, mit Blick auf den Garten. Jeden Morgen möchte ich allerdings nicht Reis und Suppe und Pickles essen. Abfahrt. Mit der Seilbahn hinauf zum Berg und Tempel Enryakuji, einem der ältesten und größten Tempel.
Von hieraus gingen viele Sekten aus. Es gibt eine Totenzone, unbetretbar für Besucher, wo im dunklen Schummerlicht Greise Rituale vollziehen. Und es gibt die Welt des Diesseits, da hocken wir ohne Schuhe in Eiseskälte. Die Andacht vergeht einem bei leichtem Schnee. Auch hier ist die Tendai-Sekte heimisch. Fahrt aus den Bergen zurück nach Kyoto-City in ein Buchgeschäft mit vielen Etagen. Hier finden wir bekannte Autorennamen, die wir Isshu ans Herz legen. Es ist erstaunlich viel übersetzt worden. Ein Bummel durch die Markt-Passagen zeigt uns, daß uns fast alle Lebensmittel unbekannt sind. Rückkehr nach Kobe. Hier erwartet uns ein herrlicher chinesischer Koch mit seinen Kochkünsten. Ein Freund von Yu-san, einem Halbchinesen und Mathematiker, der uns seit Kyoto begleitet hat.
Gegen 9 Uhr kehren wir heim in unsere Wohnung, aber oh Schreck, die Tür geht nicht auf. Es wirdein Schlüsseldienst geholt. Nach 4 Stunden hat er für 32 Tsd. Yen = 500,- DM das alte Schloß aus- und ein neues eingebaut. Abschied von Kimiko und Isshu. Todmüde fallen wir ins Bett.
9. Januar. Abfahrt von Kobe mit Hankyu-Line nach Samomiya. Von dort mit dem Bus zum Flughafen Osaka. Mit Air India nach Hongkong. 1 Stunde Zwischenaufenthalt mit chinesischer Putzkolonne und neuer indischer Crew. Dann Weiterflug nach Delhi. Wieder 1 Stunde Zwischenaufenthalt mit indischer Putzkolonne. Nach 15 Stunden Flug ohne Aussteigen Ankunft in Bombay um 2 Uhr nachts Ortszeit. Weitere 2 Stunden für den check-out, Paßkontrolle, Hotel buchen, Taxi-Ticket besorgen. 1 Stunde Fahrt bis zum Hotel Garden, vorbei an Slums und einer Geisterstadt. Um 6 Uhr morgens erschöpft ins Bett fallen.
10. Januar. Nach kurzem Schlaf weckt uns der Baulärm. Die Fenster kann man nicht öffnen, der Müllgestank davor ist zu stark. Für 60,-DM das Doppelzimmer ist es ein Schrott. Wie schön war es doch dagegen in Japan. 10 Minuten zu Fuß von der Garden Road entfernt liegt das Taj Mahal. Ein Prunkpalast. Dahinter die berühmten Herrenschneider. Wir bestellen einen Anzug für Peter aus Rohseide. In zwei Tagen soll er fertig sein. Hoffentlich. Im Taj Mahal telefoniere ich mir die Finger wund, um einen Anschluß für die Damania Airline zu bekommen. Wir buchen um auf den 13. Januar nach Goa, damit wir noch 1 Tag schwimmen können und hier aus dem Lärm, Gestank, Chaos und Dreck herauskommen. Bummel durch die Nachbarschaft. Überall Händler und buntes Treiben. Weil die Preise so niedrig sind, und wir nichts anderes zu tun haben, verfallen wir zum ersten Mal dem Shopping: Reisetasche, Sandalen, Peter schenkt mir eine schöne Blusen-Jacke aus Rohseide. –
Zum 5 Uhr-Tee im Taj Mahal in der Sea-Lounge mit Pianomusik. Peter erfreut sich am echten Tafelsilber, ich genieße die Ruhe und Gepflegtheit. Eine Insel im Meer des Unglücks. Um 6 Uhr Anprobe beim Schneider. Schon ist alles zugeschnitten und geheftet. Ein kleines Wunder an handwerklicher Eilfertigkeit bei soviel Gleichmut. Der Schneider sitzt übrigens wirklich im Schneidersitz auf dem Boden. Beim Heimbummeln will Peter noch ein Bangjuice probieren. Sie wickeln einem ein Baumblatt zusammen mit allen möglichen Pasten bestrichen. Ich gönne mir stattdessen ein orientalisches Duft-Bouquet aus Jasmin, Moschus, Patschuli. Zurück im Hotel juckt die Haut. Das unbedingte Gefühl für eine Dusche nach soviel Straßendreck. Schnell ist der Tag vergangen.
11. Januar. Nach schwerem Schlaf in stehender Hitze (die Air-Condition ist zu laut), Bummel durch den Stadtteil Colaba. Wenn man die langsame Gangart der Inder annimmt, kann man viele Impressionen sammeln. Es sind die vielen kleinen Details, die Körperhaltungen, die verschiedenen Krüppel, die Händlerwaren en miniature, die undefinierbaren Ecken, wo Müll, Kühe und Betende sich zu einem Bild verdichten. Ein Schritt neben der Hotelstraße die Elendsviertel, wo mitten im Straßendreck die Menschen mit den Tieren zusammen hocken und so tun, als wenn das Leben nicht anders sein könnte.
Nachmittags der Versuch nach Goa zu telefonieren, um den Heimflug zu bestätigen, ist wieder mal nervig. 1 Stunde Vorbestellung für das Telefonat, dann ein Stimmensalat, um schließlich festzustellen: das vom Reisebüro angegebene Telefon ist in Wirklichkeit ein Fax. Im Nachbarhotel tätige ich mein Fax. Ob die One-Way-Kommunikation klappt, wissen wir erst am Flughafen.
Ein Versuch, offiziell Geld zu wechseln, erweist sich bereits als eine kleine Entdeckungstour. Vom Grandhotel werden wir zu American- express geschickt, von dort weiter. Wir können nicht als Bank erkennen, was wie ein Elendsquartier aussieht. Durch stinkendes Abwasser, vorbei an Bettlern hinauf in den ersten Stock. Nur der Mann in Uniform vor der Tür ist ein Hinweis auf offizielle Wichtigkeit.
Mit einem Batzen Geldscheinen, die zum Teil aussehen, als wenn die Mäuse sie angefressen haben, gehen wir ins First Class Hotel von Bombay in den 21. Stock zum Buffet-Lunch. Von Seeadlern umkreist in der Höhe des Luxus, umgarnt von dienernden Geistern, der Eindruck, “reines” Essen zu bekommen ohne Angst um die Gesundheit. Und weit unter uns liegt die Stadt in ihrer Armut. Ein zwiespältiges Gefühl. Das Mitgefühl für “die da unten” verhindert den Genuß am Vergnügen. Ein Regenguß zwingt zum Verweilen, während sich der Dreck da unten in eine Kloake verwandelt.
Abends landen wir in einem Puff. Brav sitzen die Frauen in Saris an Tischen. Uns hatte die Live-Musik angelockt. Bei einem Bier genießen wir die süßlichen Männerstimmen am Mikrophon und die differenzierten Drums. Peter schaut ein bißchen irritiert drein, als sich eine Frau ihm gegenüber setzt. Nichts aufdringliches. Freundlich und still.
Im Fernsehen im Hotel der amerikanische Nachrichtensender CNN strahlt weit nach Asien hinein. Nachrichten über Vietnam, Philippinen, China sind eine Selbstverständlichkeit. Oh Europa, von hieraus betrachtet siehst du alt aus!
12. Januar. Das Taj Mahal ist unser täglicher Anziehungspunkt. Eine Oase des Luxus. Im Buchladen in der Philosophieabteilung sehen wir uns nach indischen Autoren um. Die Weisheit gehört hier den zahllosen Heiligen und Gottheiten. Wir kaufen ein Buch von Krishnamurti über “The Ending of Time” und ein Buch von Satprem über den Menschen als “transitional being”.
Die letzten Postkarten werden geschrieben, die letzten Einkäufe getätigt. Aufbruchsstimmung, Abschiedsstimmung. Werden wir wiederkommen? Gibt’s ein Wiedersehen? Die Frage bleibt offen.
Abenteuerlich sind die Gerüstbauten an den alten Palästen zu Ausbesserungsarbeiten. Die meisten Gebäude sind vollkommen heruntergekommen. Daran ranken windschiefe Bambuskonstruktionen über mehrere Etagen und abenteuerliche Handwerker klettern daran rauf und runter wie Zirkusartisten ohne Netz.
Beim dritten Gang zum Schneider ist der Anzug immer noch nicht fertig. Wir werden ernst und bestimmt. Wieder zum Schneider. Das Jackett ist fertig, die Hose nicht. Noch eine halbe Stunde bis Ladenschluß. Wir bleiben stur im Laden sitzen. Der Boss versucht uns zu unterhalten in der Wartezeit. “Vor 15 Jahren ist der Kunde, der gerade den Laden verlassen hat, das letzte Mal hier gewesen. Ein berühmter Drehbuchschreiber für den amerikanischen Film”, erzählt stolz der Tailor. Wir haben ihn kurz vorher in wichtigtuerischer Geste im Taj Mahal gesehen. Aber zum Schneider kommt er in Freak-Klamotten. Der weiß auch, wie man hier die Preise drückt, denke ich. Fünf Minuten von 20 Uhr ist die Hose endlich auch fertig. Wir zahlen. Der Schneider erhebt sich vom Schneidersitz. Sein Tagwerk ist vollbracht. Wir verbeugen uns vor ihm, denn eigentlich ist er der wahre Meister, und nicht der Boss, der die Geschäfte nur einfädelt.
Erleichtert ziehen wir ab. In der Nähe entdecken wir ein neueröffnetes Chinarestaurant. Gestern noch wurde an der Fassade geschmirgelt, heute sitzen wir in einem geschmackvollen Ambiente und genießen Stäbchen-essender-weise die Wan tan-Suppe und das Sea-food. Selig ziehen wir ab in unser Hotel-Loch.
13. Januar. 7 Uhr aufstehen. Reisefieber. Schneller Frühstück, bei dem uns alle Diener wie Mitgift-Jäger umschwirren. Sie wissen, wir reisen heute ab, und sie geben sich zum ersten Mal Mühe, um ein gutes Trinkgeld einzukassieren. Wir erlauben uns einen Scherz. Wir geben ihnen einen großen Schein für alle zusammen und das ist unerwartet. Wie in einem Hühnerhaufen allseits Aufregung deswegen. Wir amüsieren uns. 8 Uhr Abfahrt mit dem Taxi zum Flughafen durch die erwachende Stadt. Im Rinnstein hockende Alte, die aus einer Blechdose Wasser schöpfen und mit dem bloßen Finger die Zähne putzen. Entlang eines kleinen Kanals blanke Kinderpopos, die den Fluß zur Morgentoilette benutzen. Straßenfeger im Kampf gegen den Dreck. Immerhin ein Versuch.
Im Flughafen 3. Welt-Atmosphäre. Die Anzeigentafeln funktionieren nicht. Die Hinweisschilder stimmen nicht. Nur die geschäftigen Gepäckträger wissen in dem Gewühl Bescheid. Zwischen Warten und ständig wechselnden Auskünften hole ich Peter an der “Bar” einen “Kaffee”: Der Mann hinter der Theke holt einen abgenützten kleinen Plastikbeutel aus der Hosentasche, schüttet einen Bruchteil seines Inhalts in den Pappbecher und gießt heißes Wasser dazu. Der Kaffee-Beutel verschwindet dann wieder in seiner Hosentasche. Der Abflug verschiebt sich um 1 Stunde. Da aber die Ansagen über Lautsprecher nicht zu verstehen sind und die Anzeigentafeln falsch programmiert sind, erkundigt sich jeder Reisende höchstpersönlich beim Bodenpersonal. Nervig. Endlich der erlösende Abflug von Bombay nach Goa.
Da wir ein teures Hotel für die letzte Nacht in Goa gebucht haben, werden wir am Flughafen abgeholt und nach 1 Stunde Fahrt erwartet uns ein Luxushotel mit Meerblick. Ankunft 17 Uhr. Obwohl wir von früh morgens an unterwegs sind, sind wir von einer Minute zur anderen angekommen. Keine Umgewöhnungszeit. Innerhalb von kürzester Zeit schwimmen wir im Pool und baden im stürmischen Meer, strahlen und genießen. Dazu ein Glas Portwein als Willkommensgruß.
14. Januar. Nach dem Frühstück ab auf die Sonnenliegen unter wehenden raschelnden Palmen mit Blick auf brausendes Meer. Ich kann mir gar nicht vorstellen, daß heute Abend schon der Heimflug ist.